Regulierung des Immunsystems durch Tregs
Regulatorische T-Zellen (Tregs) wirken als “Bremsen” des Immunsystems. Sie sorgen dafür, dass Abwehrzellen nicht irrtümlich den eigenen Körper angreifen und verhindern so Autoimmunerkrankungen. Diese entscheidende Rolle der Tregs wurde von den Nobelpreisträgern 2025 (Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow und Fred Ramsdell) entdeckt – sie fanden heraus, dass spezielle T-Zellen mit dem Oberflächenmerkmal CD25 (und dem Schlüsselfaktor FOXP3) als Tregs autoaggressive Immunzellen unterdrücken. Unter normalen Bedingungen ist das lebenswichtig, denn ohne funktionierende Tregs kann es schon im Kindesalter zu schweren Autoimmunreaktionen kommen.
Allerdings nutzen Krebszellen diese “Friedenswächter” zu ihrem Vorteil: Tumore locken Tregs an und aktivieren sie, sodass die körpereigenen Killerzellen ausgebremst werden. Krebszellen verstecken sich also buchstäblich hinter Tregs, um der Immunabwehr zu entgehen. Moderne Therapien versuchen deshalb, diese Bremsen in der Tumorumgebung zu lösen. “Für die Krebsbehandlung liegt der Fokus darauf, die Tregs herunterzuregulieren oder zu zerstören, damit das Immunsystem gegen die bösartigen Zellen vorgehen kann”, erklärte die Karolinska-Institut-Immunologin Marie Wahren-Herlenius zur Verleihung des Nobelpreises. Während also bei Autoimmunerkrankungen oder nach Organtransplantationen an Medikamenten geforscht wird, um Tregs zu fördern, verfolgt man in der Onkologie den entgegengesetzten Ansatz: Tregs gezielt abschwächen, damit die körpereigene Abwehr wieder Vollgas gegen den Tumor geben kann.
Natürliche Polyphenole als immunologische Hilfe
Die Erkenntnisse über Tregs haben eine intensive Suche nach Wirkstoffen ausgelöst, die diese Zellen beeinflussen können. Neben monoklonalen Antikörpern oder gentechnologischen Ansätzen rücken auch natürliche Substanzen in den Blick. Polyphenole – eine Gruppe von pflanzlichen Inhaltsstoffen, zu denen u.a. bestimmte Antioxidantien aus Grüntee, Trauben oder Obst gehören – zeigen nämlich bemerkenswerte immunmodulatorische Effekte. Drei prominente Beispiele sind EGCG, Resveratrol und Quercetin. Diese Stoffe sind für sich genommen keine Heilmittel gegen Krebs, könnten aber begleitend in der Immunonkologie hilfreich sein. Sie scheinen in der Lage zu sein, das Gleichgewicht des Immunsystems zu beeinflussen – mal bremsend, mal beschleunigend – je nach Bedarf. Im Kontext der Tumorbekämpfung ist besonders interessant, dass sie in Labor- und ersten klinischen Studien die Zahl oder Wirkung von Tregs reduzieren und gleichzeitig die tumorbekämpfenden Immunzellen stärken können. Im Folgenden wird erläutert, wie diese Polyphenole wirken und wie man sie sich – basierend auf den neuen Nobelpreis-Erkenntnissen – zunutze machen könnte.
EGCG – Grüntee-Extrakt mit Anti-Treg-Effekt
EGCG (Epigallocatechingallat) ist das wichtigste Polyphenol im grünen Tee. Grüner Tee gilt seit langem als gesund, u.a. wegen antioxidativer und entzündungshemmender Eigenschaften. Neuere Untersuchungen zeigen nun, dass EGCG auch das Immunsystem im Tumorumfeld positiv beeinflusst. Vereinfacht gesagt kann EGCG dafür sorgen, dass die Immunabwehr weniger gebremst wird.
So wurde in einer klinischen Studie mit Leukämiepatienten (chronische lymphatische Leukämie) beobachtet, dass ein Grüntee-Extrakt (reich an EGCG) die Treg-Zahl im Blut deutlich verringerte. Gleichzeitig sanken zwei Schlüsselsignale, mit denen Tregs normalerweise die Immunreaktion dämpfen: das Interleukin-10 (IL-10) und TGF-β[7]. Ähnliche Ergebnisse zeigten sich in einer weiteren Studie an Patienten mit akuter myeloischer Leukämie, die über mehrere Monate Grüntee-Polyphenole einnahmen: Die Häufigkeit von Tregs sank, während zugleich mehr aktive Killer-T-Zellen (CD8⁺) und natürliche Killerzellen nachweisbar waren[8]. Hier deutet sich an, dass EGCG eine Art Entfesselung der Anti-Tumor-Immunkomponenten bewirkt, indem es die Treg-bedingte Bremse lockert.
Auch in Tiermodellen zeigen sich diese Effekte. In einem Mausmodell von Hautkrebs (Melanom) führte EGCG-Behandlung dazu, dass Tumorzellen weniger PD-L1 exprimierten – PD-L1 ist ein “Tarnkappen”-Protein mit dem Tumore sich vor Immunangriffen verstecken. Zudem ging die Anzahl der immunsuppressiven Tregs im Tumorgewebe zurück, was den erschöpften zytotoxischen T-Zellen erlaubte, ihre Tumor-killer-Funktion wieder aufzunehmen[9]. Insgesamt deuten diese Studien darauf hin, dass EGCG gezielt Tregs schwächen und deren hemmenden Einfluss mindern kann[9][10].
Wichtige Wirkungen von EGCG im Tumor (Beispiele aus Studien):
· Ein Grüntee-Extrakt (mit hohem EGCG-Gehalt) verringerte bei Leukämiepatienten die Anzahl zirkulierender Tregs und senkte gleichzeitig die Spiegel der von Tregs ausgeschütteten Hemm-Botenstoffe IL-10 und TGF-β[7].
· In einer weiteren Patientengruppe (Leukämie) führte EGCG zu weniger Tregs sowie aktiveren Killerzellen: Das Verhältnis von zytotoxischen CD8-T-Zellen und NK-Zellen mit aktivem Profil stieg an[8].
· Im Mausmodell (Melanom) blockierte EGCG einen wichtigen Immun-Evasion-Mechanismus des Tumors: Tumorzellen produzierten weniger PD-L1, und es infiltrierten deutlich weniger Tregs das Tumorgewebe. Dadurch konnten die körpereigenen T-Killerzellen wieder effektiver Tumorzellen zerstören[9].
Diese Ergebnisse legen nahe, dass EGCG als natürliches “Immun-Booster”-Adjuvans genutzt werden könnte. Es würde dann parallel zu konventionellen Krebstherapien verabreicht, um das Immunsystem zu unterstützen – indem es die tumorbedingte Immunbremse (Tregs) löst und den Angriff der Immunzellen verstärkt[10]. Wichtig ist, dass grüner Tee und EGCG im Allgemeinen gut verträglich sind und kaum schwere Nebenwirkungen bekannt sind, was ihren Einsatz in klinischen Studien erleichtert.
Resveratrol – Polyphenol aus roten Trauben
Resveratrol ist ein pflanzliches Polyphenol, das vor allem in der Schale roter Trauben (und somit in Rotwein) vorkommt. Es erlangte Bekanntheit als „gesundheitsfördernder“ Stoff im Rotwein, unter anderem durch den diskutierten Nutzen für Herz-Kreislauf und Alterungsprozesse. Inzwischen zeigt sich, dass Resveratrol auch antitumorale und immunmodulierende Eigenschaften besitzt. Im Kontext der Tregs bedeutet das: Resveratrol kann das Tumor-Immungleichgewicht wieder zugunsten der Angreifer-Zellen verschieben.
In verschiedenen präklinischen Studien (Tumormodellen) beobachtete man, dass Resveratrol gezielt die Anzahl der Tregs verringert und gleichzeitig die effektorischen Immunzellen stärkt. Beispielsweise führte Resveratrol in Mausmodellen von Leberkrebs dazu, dass sowohl CD4⁺FOXP3⁺-Tregs als auch CD8⁺CD122⁺-Tregs (eine spezielle Treg-Variante) signifikant reduziert wurden[11]. Interessanterweise schrumpfte damit auch der Anteil sogenannter M2-Makrophagen – das sind Tumor-assoziierte Fresszellen, die eher das Tumorwachstum fördern. Parallel dazu wurden mehr CD8⁺-T-Zellen mit Interferon-γ (IFN-γ) – einem wichtigen krebsbekämpfenden Signalstoff – im Tumor gefunden[11]. Resveratrol drehte also das Immunprofil im Tumor in Richtung “Anti-Krebs”: weniger Bremszellen, dafür mehr Angriffszellen.
Diese Veränderung ging einher mit deutlichen Verschiebungen bei den Immun-Botenstoffen. In den behandelten Tumoren sanken die Spiegel der bremsenden Zytokine TGF-β1 und IL-10, während proinflammatorische, tumorfeindliche Mediatoren wie TNF-α und IFN-γ anstiegen[12]. Das zeigt, dass Resveratrols Effekt zwei Ebenen hat – quantitativ (weniger Tregs) und funktionell (weniger Hemmstoffe, mehr Angriffssignale).
Auch in einem Melanom-Modell (Hautkrebs bei Mäusen) wurden ähnliche Resultate erzielt: Durch Resveratrol-Gabe wurden die Tumor-“Bremsen” gelockert – gemessen an einem deutlichen Rückgang von TGF-β – und die Menge der Tregs (identifiziert als CD4⁺CD25⁺ Zellen) wurde reduziert[13]. Sogar unter erschwerten Bedingungen, z.B. während einer Strahlentherapie, zeigte ein Resveratrol-Derivat (HS-1793) in einem Brustkrebsmodell, dass es die Anzahl der Tregs weiter senken und die Produktion von IL-10 und TGF-β (also die immununterdrückenden Faktoren) dämpfen konnte[14].
Forschungs-Highlights zu Resveratrols immunologischer Wirkung:
· In Mausmodellen von Leberkrebs reduzierte Resveratrol die Treg-Population deutlich. Gleichzeitig nahm die Zahl der M2-Tumormakrophagen (die das Tumorwachstum fördern) ab, während aktive CD8⁺-T-Killerzellen vermehrt IFN-γ produzierten – ein Hinweis auf gesteigerte Anti-Tumor-Immunität[11]. Zudem wurden hemmende Zytokine im Tumor (TGF-β1, IL-10) deutlich heruntergefahren, während entzündliche Mediatoren wie TNF-α zunahmen[12].
· In einem Melanom-Mausmodell führte Resveratrol zu weniger immununterdrückenden Signalen: Das Tumorgewebe wies geringere TGF-β-Werte auf, und die Population der Tregs (CD4⁺CD25⁺) ging zurück[13].
· Ein Resveratrol-Analogon (HS-1793) konnte in Kombination mit Strahlentherapie die Tregs weiter verringern und die Freisetzung von IL-10 und TGF-β unterbinden. Dadurch wurde die durch Bestrahlung verursachte Immunsuppression in einem Brusttumor-Modell teilweise aufgehoben[14].
Resveratrol zeigt somit ein großes Potenzial als Immunmodulator im Tumorkontext. Durch das Zurückdrängen der Tregs und anderer immunsuppressiver Zellen (wie der M2-Makrophagen) kehrt es das immunologische „Mikroklima” des Tumors um – weg von Toleranz, hin zu Angriff[15]. Bemerkenswert ist, dass diese Effekte in verschiedenen Tumorarten ähnlich beobachtet wurden (Leberkrebs, Hautkrebs, Brustkrebs), was auf einen generellen Mechanismus hindeutet. Zwar stammen die meisten Daten aus Tiermodellen, doch sie liefern eine klare biologische Rationale: Resveratrol könnte als begleitender Wirkstoff in der Krebstherapie dienen, um das Immunsystem anzukurbeln. Aufgrund seiner natürlichen Herkunft und geringen Toxizität wäre es ideal als Ergänzung zu bestehenden Therapien – zumal es aufgrund seiner vielfältigen Angriffspunkte (Signalwege wie STAT3, Immunzelltypen wie Tregs und Makrophagen) mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen könnte.
Quercetin – pflanzliches Flavonoid mit doppelter Wirkung
Quercetin ist ein weit verbreitetes Polyphenol (ein Flavonoid), das in vielen Früchten und Gemüsesorten vorkommt (z.B. Äpfeln, Zwiebeln, Beeren). Es ist bekannt für antioxidative und antientzündliche Wirkungen. In der Immunonkologie erregt Quercetin Aufmerksamkeit, weil es gleich doppelt wirkt: Es kann einerseits immunhemmende Mechanismen (wie Tregs) abschwächen und andererseits die direkten Abwehrkräfte gegen den Tumor stärken.

Schematische Darstellung am Beispiel Quercetin: Quercetin (grünes Molekül) beeinflusst das Tumor-Immunmilieu, indem es hemmende Signale blockiert (blaue Linien) und abwehrfördernde Signale aktiviert (rote Pfeile). Zum einen hemmt Quercetin entzündungsfördernde Kaskaden wie IL-6 → JAK2 → STAT3, welche normalerweise Tregs, IL-10 und PD-L1 induzieren[16]. Dadurch produzieren Tumorzellen weniger PD-L1 (ein „Tarnsignal“) und Tregs sowie IL-10 werden vermindert – die Immunbremse lockert sich also. Zum anderen fördert Quercetin über andere Pfade (z.B. durch Beeinflussung von CD47/PDK1-Signalen) die Umwandlung von Makrophagen zur M1-„Kriegsform” und stimuliert CD8⁺-T-Zellen. Mehr tumorbekämpfende M1-Makrophagen, mehr zytotoxische T-Zellen und erhöhte Ausschüttung von IL-2 und IFN-γ sind die Folge[16]. Unterm Strich verschiebt Quercetin das Gleichgewicht im Tumor weg von Unterdrückung hin zur aktiven Immunabwehr.
Dass diese Mechanismen nicht nur Theorie sind, zeigen Studien in Modellsystemen: In einem Brustkrebs-Mausmodell (Triple-negatives Mammakarzinom, 4T1) bewirkte Quercetin, dass das lokale Immunsystem deutlich aggressiver gegen den Tumor wurde. Man maß erhöhte Werte an IL-2 und IFN-γ – beides Botenstoffe, die T-Zellen und NK-Zellen aktivieren – sowie einen Rückgang von IL-10, dem immunsuppressiven Zytokin der Tregs[17]. Begleitend fand man mehr CD4⁺- und CD8⁺-T-Zellen im Tumor, speziell eine Zunahme aktiver Killerzellen, und gleichzeitig weniger Tregs[17]. Auch die natürlichen Killerzellen (NK) infiltrierten den Tumor verstärkt[18]. Diese Verschiebung zugunsten der Effektorzellen passt zu den oben erwähnten molekularen Wirkungen von Quercetin.
Forscher konnten zudem den genauen Signalweg identifizieren, über den Quercetin die Bildung von Tregs unterdrückt: Es blockiert den IL-6/JAK2/STAT3-Pfad, der in vielen Tumoren chronisch aktiviert ist und normalerweise die Entstehung von Tregs und die Freisetzung von IL-10 antreibt[19]. Durch diese Blockade bleibt den Tumorzellen auch ein wichtiger Fluchtmechanismus verwehrt – die Expression von PD-L1 wird reduziert, was bedeutet, dass die Tumorzellen sich weniger effektiv vor den T-Killerzellen verstecken können[16]. Zusätzlich beeinflusst Quercetin die angeborene Immunabwehr im Tumor: Es bremst die Ausbildung von tumorfördernden M2-Makrophagen (u.a. durch Hemmung des Botenstoffs CXCL8) und unterstützt die Rekrutierung bzw. Aktivierung von M1-Phagozyten, die den Tumor attackieren[20][21]. Insgesamt trägt Quercetin also dazu bei, das Tumorgewebe für das Immunsystem “heiß” zu machen – aus einem immunologisch “kalten”, versteckten Tumor wird ein sichtbares Ziel, das von den Abwehrzellen erkannt und bekämpft werden kann[21][16].
Schlüsselbefunde zu Quercetin in der Krebsimmunologie:
· In einem aggressiven Brustkrebs-Modell erhöhte Quercetin die Konzentration der immunaktivierenden Botenstoffe Interleukin-2 und Interferon-γ, während es den immunsuppressiven Faktor IL-10 senkte. Begleitet wurde dies von einer Zunahme aktiver CD4⁺- und CD8⁺-T-Zellen sowie NK-Zellen im Tumor und einem Rückgang der Treg-Zellen[17]. Mit Quercetin behandelte Mäuse hatten also ein deutlich wehrhafteres Tumor-Immunsystem als unbehandelte.
· Quercetin blockiert gezielt die IL-6/JAK2/STAT3-Signalkaskade, die in Tumorzellen häufig eine immununterdrückende Umgebung aufrechterhält. Dadurch werden weniger Tregs und IL-10 gebildet und die Tumorzellen exprimieren weniger PD-L1[16]. Praktisch bedeutet das, dass die Tumorzellen verwundbarer für einen Immunangriff sind, da die „Schutzblase” aus Tregs und PD-L1 schrumpft.
· Gleichzeitig fördert Quercetin die anti-tumorale Immunantwort: Es erleichtert die Umstellung von Fresszellen in den M1-Modus (tumorzerstörend) und unterstützt die Vermehrung sowie Aktivität von zytotoxischen CD8-T-Zellen (erhöhte IL-2- und IFN-γ-Produktion)[16]. Auch andere hemmende Zellen im Tumor (z.B. bestimmte myeloische Suppressorzellen) werden reduziert, während die natürlichen Killerzellen in ihrer Tumorabwehr gestärkt werden[16].
Zusammengefasst wirkt Quercetin wie ein Immun-Taktgeber, der das Zusammenspiel im Tumormikromilieu neu justiert: Weg von Immuntoleranz, hin zu aktiver Bekämpfung. Dies macht Quercetin zu einem vielversprechenden Kandidaten als unterstützende Maßnahme in der Krebstherapie.
Quellen: Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow & Fred Ramsdell (Nobelpreis 2025, Entdeckung der Tregs); Aktuelle Forschungsarbeiten zu EGCG[7][9], Resveratrol[11][14] und Quercetin[17][16] in der Krebsimmunologie; sowie Hintergrundinformationen zur Immunologie des Krebses[6][4].
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [22] Nobel prize in medicine awarded to scientists for immune system research | Nobel prizes | The Guardian
[7] [8] [9] [10] [24] [25] [26] Frontiers | The roles of epigallocatechin gallate in the tumor microenvironment, metabolic reprogramming, and immunotherapy
https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2024.1331641/full
[11] [12] [13] [14] [15] Recent Advancements on Immunomodulatory Mechanisms of Resveratrol in Tumor Microenvironment
https://www.mdpi.com/1420-3049/26/5/1343
[16] [17] [18] [19] [20] [21] [23] [27] Frontiers | Synergistic chemotherapy and immunomodulatory effects of Quercetin in cancer: a review
https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2025.1547992/full
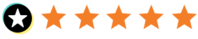 basierend auf
Bewertungen
basierend auf
Bewertungen
